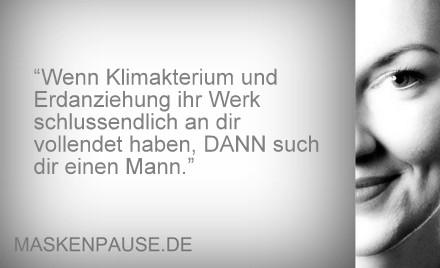OLE 1
Der schönste Moment des Einkaufs war die Pfandrückgabe. Zum ersten Mal nimmt der Automat einfach jede Flasche an. Lässt keine zurückgehen. Das ist mir noch nie passiert. Ich nehme immer mindestens eine Flasche frustriert wieder mit heim. Dieserart euphorisiert kaufe ich mehr Spargel, mehr Erdbeeren, mehr Gurken und mehr Radieschen, als es sich für meinen Eigenbedarf geziemt. Mit rund gefüllten Stofftaschen betrete ich den Hausflur.
Als ich den Fuß in den dritten Stock setze öffnet sich die Tür vor mir.
„Moin, Ole.“
„Moin.“
Ole wirkt verschlafen. T-Shirt und Gesichtshaut weisen einen identischen Knitterigkeitsgrad auf. Er blinzelt ins Lampenlicht über uns.
„Dich sieht man auch nie.“
„Bin viel unterwegs, Ole, weißte doch.“
„Ja. Und genau das ist das Problem. Wir sind zu viel unterwegs.“
„Du auch?“
„Ja. Aber … der erste Schritt ist ja, das Problem zu erkennen. Weißt du, wir sind ja keine 20 mehr. Oder 30.“
Ich unterbreche Ole nicht, frage mich allerdings, warum mir zur Zeit ständig Menschen begegnen, die mich ungefragt daran erinnern, dass ich keine 30 mehr bin. Bestimmt fängt er gleich von den Wechseljahren an.
„Und wenn man weiß, dass man keine 30 mehr ist, dann wird die Luft dünn! Sehr dünn.“
„Nanana, Ole….Samstagsdepression?“
„Vielleicht. Wir sind einfach zu viel unterwegs.“
„Ich hab gerade Urlaub.“
„Echt?“
„Echt.“
„Und was machste?“
„Wohnen.“
„Wohnen ist super. Ich bin eigentlich nicht zu viel unterwegs. Ich lasse mich nur von meinem Hobby auffressen.“
„Äh….aber das kannst du doch selbst bestimmen. Reduzier es einfach?“
„Da hast du recht. Ja.“
„Allerdings: was machst du dann in der gewonnenen Zeit?“
Oles Blick geht gedankenverloren an mir vorbei. Mit einem sanften Klick erlischt das Flurlicht. Wir stehen im Dunkel. Ich höre seine Schritte, unsere Arme berühren sich, kurz bevor er die Treppe erreicht. Im zweiten Stock bleibt er kurz stehen. Er seufzt.
„Ich suche mir ein neues Hobby.“
_ _ _ _
OLE 2
Tag eins nach meinem Termin beim Kieferchirurg. Ich habe den Müll weggebracht. Auf der Treppe hinauf zur Wohnung kommt Ole mir entgegen.
„Moin.“
„Moin.“
„Na, alles gut?“
„Ja, danke.“
Ole bleibt stehen.
„Du siehst anders aus. Haare?“
„Nein.“
„Ich dachte…naja…bei euch Frauen sind es doch immer die Haare.“
„Diesmal nicht.“
„Aber anders stimmt doch, oder?“
„Wenn du so willst….“
„Warte…ich komm drauf!!“
Er mustert mich.
„Du hast keine Brille auf.“
„Ole, ich hab nie eine Brille auf. Zumindest nicht, wenn ich dir begegne.“
„Aber du hast eine?“
„Ja.“
„Aber das isses nich?“
„Nein.“
„Dann weiß ich nicht.“
„Es….“
„Halt! Ich hab‘s! Du hast dir so’n Zeugs spritzen lassen!“
„Ich …?“
„Schief gegangen? Mist sowas! Jetzt seh ich es auch. Völlig schief! Du bist völlig schief gespritzt! Rechts ist total …dick!“
„Maaaaannnnn! Oleeeee! „
„Was denn?“
„Ich sag nix mehr …“
Gehe an ihm vorbei, weiter nach oben.
„Also lieg ich falsch oder was?“
Ich bin schon fast ganz oben. Ole erhebt die Stimme leicht kreischig.
„Jetzt sag doch mal! Es ist aber doch alles schief!“
Ich schließe meine Tür auf und lasse sie deutlich hinter mir ins Schloss fallen. Ich höre Oles Schritte die Treppe hinunter poltern. Die Haustür fällt theatralisch donnernd ins Schloss. Meine Klingel schrillt. Ich betätige die Gegensprechanlage.
„Ja?“
„Ich weiß gar nicht, warum du jetzt beleidigt bist! Aber den Arzt solltest du verklagen.“
Ich lege auf.
Hier wohnen echt nur Diven.
_ _ _ _

_ _ _ _
OLE 3
Tür zu. Schuhe direkt vom Fuß in die Ecke schleudern, Tasche hinterher. Kopfhörer auf. Max Volume. Naja – fast max. Ich hüpf-zuck-schreite vom Wohn- ins Schlafzimmer und zurück. Bei manchen Songs produziert mein Körper Bewegungsabfolgen, die er sonst gar nicht kennt. Ich könnte eine Vodoopuppen durchbohren. Baue aber dann doch einsichtig mit Love Shack von den B52’s den Adrenalinspiegel ab. Repeat. Repeat. Repeat.
Ich ertanze kurz Küche und Bad, um durch Flur und Wohnzimmer wieder gen Schlafraum zu zucken. Augen schließen. Wilde Drehung. Augen öffnen.
Ein fast schmerzhafter Schreckensblitz durchfährt mich. 100% Adrenalin bis in bereits herabfallende Hautschüppchen. Mein Kiefer ist im Konflikt, ob er sich für einen Schrei lösen oder zwecks Zunge abbeißen zusammenschnellen soll. Der Ausfallschritt seitwärts vollzieht sich ruckartig und vollautomatisch. Ich knicke leicht ein mit dem Fuß, wanke etwas nach hinten. Meine rechte Hand reißt mir die Kopfhörer runter, gleichzeitig schnelle ich wieder nach vorne und nun schreie ich tatsächlich mit spürbar aufsteigender Zornesröte: „Sag mal bist du bescheuert?“
Ole weicht spontan zurück und hebt schützend die Hände vor sich.
Es schreit mich weiter: „Wie kannst du einfach hier reinkommen? Bist du noch zu retten?“
Ole senkt die Hände, um dann wieder die rechte Hand zu heben. In ihr baumelt ein Schlüsselbund.
Ich schreie ungerührt weiter: „Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Wie kannst du einfach meine Wohnung betreten? Ich glaub du bist nicht ganz dicht!“
Ole wedelt mit dem Schlüsselbund.
„Der steckte draußen.“
„Der steckte…?“
„Ja.“
„Ja und? Du hättest trotzdem klingeln können!“
„Hab ich.“
Ich bin kreischig: „Ach ja? Ich hab nichts gehört.“
Ole zeigt auf meine Kopfhörer und verdreht die Augen. Sein Blick ist nun vorwurfsvoll.
„Ich wollte sicher gehen, dass du deinen Schlüssel auch bekommst.“
„Aufschließen, Schlüssel innen einstecken, Tür wieder zuziehen. Fertig.“
„Ich war ja nicht sicher, ob du wirklich da bist.“
„Bitte? Ich hab mitgesungen!“
„Hätte ja wer anders sein können.“
„Hätte ….? Das ist doch wurscht! Du kannst nicht einfach mitten in meiner Wohnung stehen!“
„Ich hatte ein seltsames Gefühl.“
Meine Stimme ist immer noch laut.
„Danke, das hab ich jetzt auch.“
Oles Schultern sinken herab. Er ist ohnehin ein wenig naturkrumm, aber jetzt wirkt er wie eine in die Jahre gekommene Trauerweide.
„Da.“
Er legt den Schlüssel auf die Kommode und wendet sich zum Gehen.
„Ich hab mich zu Tode erschrocken, Ole! Ist das so schwer zu verstehen?“
„Ich hatte ein komisches Gefühl!“
„Ja, Herrgottnochmal!“
Ole ist mit wenigen, großen Schritten im Hausflur. Er dreht sich um, greift nach dem Türgriff und bevor er mit wirklich finsterer Miene die Tür vor meiner Nase zuzieht, macht er sich plötzlich sehr, sehr gerade:
„Und ich würde das wieder tun!“
Das Türschloss klickt konsequent einer Erwiderung entgegen. Die Kopfhörer in meiner Hand vibrieren. In ihnen setzen die B52’s zum nächsten Repeat an.
_ _ _ _
OLE 4
„Moin.“
„Moin, Ole. Alles klar?“
„Sag mal, du wohnst doch direkt über A., oder?“
„Keine Ahnung. Ich kenn ja kaum jemand aus dem Haus.“
„A. sagte neulich, sie kenne niemanden, die soviel auf dem Boden fallen ließe, wie die Person über ihr.“
„Oha.“
„Das musst du sein.“
„Warum MUSS das ich sein? Ich bin total oft gar nicht da!“
„Aber wenn, dann fällt was hin.“
„Also…“
„Doch. Ist mir auch schon aufgefallen. Du hupst auch total oft aus Versehen beim Aussteigen.“
„Ich…“
„Das finde ich bemerkenswert. Wenn ich dein Auto vorfahren sehe, schließe ich die Augen und weiß: gleich hupts.“
„Das ist überhaupt nicht wahr!“
„A. hat das auch gesagt. Sie weiß aber nicht, dass du auch die bist, die alles fallen lässt.“
„Sag mal, was wird das denn hier?“
„Muss man doch mal sagen dürfen. Wir sehen uns ja sonst nicht.“
In diesem Moment fällt mir mein Schlüsselbund aus der Hand. Als ich mich bücke, um ihn aufzuheben, purzeln mehrere Kugelschreiber aus meiner geöffneten Tasche. Ole hebt Kulis auf.
„Ich sage da jetzt nichts zu.“
„Ist besser, Ole, ist besser.“
„Warum hupst du eigentlich nie beim Einsteigen?“
„Ich ….“
„Na, egal. ich muss los. Schönen Tag dir!“
Ja. Ich versuchs.
_ _ _ _
OLE 5
Begegnung mit Ole im Treppenhaus:
„Moin.“
„Moin.“
_ _ _ _
OLE 6
Aus dem Briefkasten fallen mir mehrere Prospekte entgegen. Warum hab ich eigentlich den Anti-Werbung-Aufkleber angebracht? Ich bücke mich zu den Angeboten zweier Pizzadienste und eines Mobilfunkanbieters. Hinter mir wird die Haustür geöffnet. Ole. Ich gelange dezent schnaufend zurück in meine aufrechte Haltung und schließe den Briefkasten.
„Ganz schön rot, dein Mantel!“
„Ich mag rot.“
„Sieht man.“
„Und selbst?“
„Ja, muss.“
„Muss was?“
„Ach.“
„Hm.“
„Aber zu groß isser, der Mantel.“
„Ja. Bisserl. Aktuell. Aber keine Sorge, ich wachse wieder rein.“
„Ach, der ist nicht neu?“
„Nein.“
„Bald ist Vollmond.“
„Bald ist Vollm…äh…ja, mag sein.“
„Ich verstehe nicht, weshalb der Mond die Weiblichkeit symbolisiert.“
Ole blickt jetzt an mir vorbei, als könne er auf der Wand hinter uns einen Publikumsjoker auswählen.
„Der Mond symbolis…äh…Ole? Wie kommst du denn jetzt auf den Mond?“
„Na, dein Mantel! Und dass du wieder reinwächst! Ist doch so’n Frauending!“
„In Mäntel zu wachsen?“
„So ungefähr.“
„Und was hat der Mond damit zu tun?“
„Der nimmt auch immer zu und ab.“
„Na, dann passt es ja zu deinem Bild von Weiblichkeit.“
„Nee. Neeeeee, neeeeee. Der Mond mault nicht darüber! Der macht das zyklisch elegant!“
„Der macht das…zykl…äh….wann hab ich denn gemault?“
„Haste nicht.“
„Ha!“
„Noch nicht.“
„Ich …“
„Nee. Sag nix! Außerdem: ich zieh aus nächste Woche.“
Mir fallen die Prospekte aus der Hand und flattern zu Boden.
„DU ZIEHST AUS?“
„Nicht laut werden!“
„Warum? Wohin? Warum? Wohin?“
„Bremen. Job. Läuft.“
Ich suche einen Telefonjoker. Treppenhausjoker. Nicht mal 50:50 ist greifbar.
„Ja…dann…also….“
„Ja. Und lass deine Schlüssel nicht mehr draußen stecken.“
„Nein.“
„Gut.“
Das Treppenhauslicht geht aus. Ole drückt auf den Lichtschalter. Ich bücke mich nach den Prospekten. Schnaufe beim Aufheben. Ole geht schon Richtung Treppe.
„Ole?“
„Ja?“
„Mach‘s gut!“