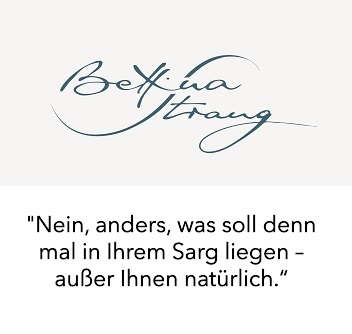Henk hat einmal gesagt, ich müsse der Nacht zuvorkochen, wenn ich sie heraufziehen sehe. Also ging ich los, Pastinaken kaufen, weil Pastinaken der Nacht ihre erdige Süße entgegenstellen, ihr Aroma tief in mir aus unerfindlichen Gründen ein glaubwürdiges „Es geht vorbei“ entfaltet, das dieserart, wenn überhaupt je, nur der tröstend flüsternden Stimme meiner Mutter zu entnehmen war. Früher. Ich weiß nicht mehr wann.
Neben dem Wurzelgemüse stand ein Korb mit Feldsalat. Ohne zu überlegen füllte ich eine mittelgroße Papiertüte mit den dunkelgrünen Blattsträußchen, griff drei Pastinaken, eine Möhre und hastete zur Kasse.
Heute war ich froh um jedes nicht gesprochene Wort. War froh im separaten Büro, ohne Gegenüber. Sagte „Ach, wenig geschlafen“ zu den musternden, halb fragenden Blicken.
Gestern Abend hatte ich mich trotz allem in den Wind begeben. Das Wetter. Den nervnadeligen Regen. Hatte mir, trotz aller Vorbehalte, vorgenommen „Monets Garten“ zu besuchen. Eine multimediale Ausstellung. Ein immersives Erlebnis. Eintauchen also. Eintauchen klang gut.
Du musst auch mal raus. Was anderes sehen.Auf dem Sofa liegen kannst du noch, wenn du tot bist. (Really?)
Kam an. Durchnässt. Klammkalt mit hochroten Händen, obwohl es gar nicht mehr klirrend hier ist. Hing den Mantel an die Garderobe. Stand vor sich bewegenden, multimedialen Bildern. Kam in einen großen Raum mit großer Projektionswand, der wie ein Garten gestaltet war. Ein billiger Garten aus Chinaplastik, mit blutleeren Seerosenanimationen auf dem Boden. Auf der großen Projektionswand flirrende Farbschnipsel, die wie mit einem Knethaken ineinander gerührt wirkten.
„Nichts zu finden“ weiterlesen