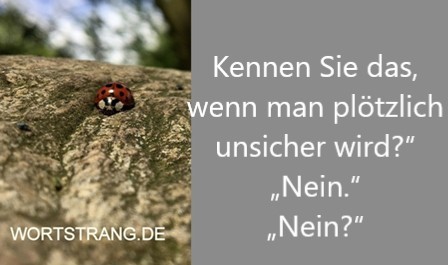„Was hast du in Brandenburg gemacht?“
„Woher weißt du, dass ich in Brandenburg war?“
„Na, von facebook.“
„Du bist nicht auf facebook!“
„Ich nicht. Aber Joe. Und gestern war ich bei Joe und der war mit mir auf facebook.“
„Mia, wer ist Joe?“
„Ein Freund von mir. Und von dir. Von dir auf facebook.“
„Ich hab keinen Joe auf facebook.“
„Da heißt er auch anders. Irgendsowas normales. Ich glaub auf facebook heißt er Hans.“
„Hans? Und real heißt er Joe?“
„Ich glaub ja.“
„Was heißt du glaubst? Ihr seid doch befreundet.“
„Ja, aber doch nicht so.“
„Wie NICHT SO? Wie ist man denn befreundet, wenn man nicht weiß, ob jemand Joe oder Hans heißt?“ „Hansmoment mit Mia“ weiterlesen
Ein Huhn
Ein Huhn ruft merklich aufgeregt:
„Verflixt, ich hab das Ei verlegt!“
Es sucht im Heu, es wühlt im Stroh.
Kein Ei, nicht hier, nicht irgendwo.
Der Gockel will mit Plan vorgehn!
„Wo hast du es zuletzt gesehn?“
Das Huhn zischt deutlich angefressen:
„Gesehn? Ich hab darauf gesessen!“
Und wie im Stall die Fetzen fliegen,
weil Huhn und Gockel sich bekriegen,
kommt durch die Tür -entspannt- das Ei,
als ob gar nix gewesen sei.
„Da bist du ja! Wir hatten Ängste!“
Das Ei rollt mit den Augen: „Denkste,
dass so ein Helikopterhintern
mich nicht erdrückt beim überwintern?
Den ganzen Tag piekst mich das Stroh.
Und drüber dieser warme Po!
Ich musste aus der Federgruft
mal eben an die frische Luft.“
Dann schiebt das Ei sich brutgemäß
unter des Huhnes Brutgesäß.
Im Stall wird’s still. Nicht mal der Hahn
hat einen neuen Tagesplan.
(c)strang 2019
Miamalwiedermoment
„Ah! Du bist da! Ich dachte du wärst noch in Rom.“
„Wien.“
„Wien? Warum bist du in Wien?“
„War. Ich war in Wien, Mia.“
„Nicht in Rom? Naja, auch egal. Ich verwechsle da bestimmt was.“
„Bestimmt. Warum rufst du an, wenn du denkst, dass ich gar nicht da bin?
„Weil es eh egal ist. Ich kann ja auch auf das Band sprechen. Ist fast gleich.“
„Ist was passiert?“
„Mir? Nein. Dir?“
„Nein. Jetzt lass dir halt nicht alles aus der Nase ziehen.“
„Was bist du denn so kratzbürstig? Ich weiß schon, warum ich auf das Band sprechen wollte.“
„Ich bin überhaupt nicht kratzbürstig. Ich meine es ernstlich nett: Soll ich auflegen? Dann rufst du nochmal an und ich geh nicht ran.“
„Meine Güte, was für eine miserable Laune! Hast du zu lang im Kaffeehaus gesessen? Wirklich, es wundert mich kein Stück, dass du so viel alleine bist. Das ist ja nicht auszuhalten. Naja. Was ich dir aufs Band sagen wollte: Hatte ich dir das von Margret erzählt? Dass sie ausgezogen ist? Hatte ich, glaub ich. Jedenfalls ist sie seit zehn Tagen endlich raus aus dem Haus und ihr Götter-Ex ist wieder drin und nun ruft sie jeden Abend bei mir an. Jeden Abend! Und heult mir die Ohren voll. Wirklich, du kennst mich, ich bin nicht dafür gemacht, dass man mir die Ohren vollheult. Aber jetzt kommt das Schärfste. Wenn ich dir das sage, weißt du was los ist. Sie heult wegen der Küche! Hast du sowas schon gehört? Sie vermisst ihre Küche! Sie sagt, die Küche in der neuen Wohnung ginge ihr ans Gemüt. Weil man beim Kochen auf die Wand und nicht aus dem Fenster gucken kann. Ich meine, tausende Menschen gucken auf die Wand beim Kochen! Wie leben die denn alle …? Ich hab ihr gesagt, sie soll halt einfach in den Topf gucken, da sei es auch grün. Dann hat sie geheult!“
„Ich …“
„….bitte dich! Man heult doch noch nicht wegen fehlender Küchenfenster!“
„Hat sie denn gar keins?“
„Natürlich hat sie eins! Nur nicht vorm Herd! Wie tausende andere!“
„Weshalb sie in den Topf gucken soll.“
„Na, Himmel, was soll man denn da sagen? Wenn sie wenigstens ihre Regenwalddusche vermissen würde! Oder den Strandkorb auf der Terrasse.“
„Oder den Mann.“
„Nee!“
„Ja, okay.“
„Wo guckst du eigentlich hin beim Kochen?“
„In den Topf.“
„Mein Gott, bist du übellaunig!“
„Mia! Ich guck wirklich in den Topf!“
„Niemand guckt dauernd in den Topf!“
„Ich habe nicht gesagt, dass ich dauernd in den Topf gucke.“
„Beim nächsten Mal sprech ich aufs Band. Du bist wirklich nicht auszuhalten! Dabei ist Rom so schön!“
Klick.
„Wien!“
Umtauschmoment
„Waren Sie nicht heute Mittag schon mal zum Umtauschen da?“
Ich habe eine andere Mütze aufgesetzt, in der Hoffnung die Frau an der Kasse würde mich nicht wiedererkennen. Vergeblich.
„Ja, das war ich. Es ist mir auch etwas unangenehm, dass ich auch diese Bettwäsche wieder umtauschen muss.“
„Was ist nicht Ordnung?“
„Es ist wieder die falsche Größe.“
„Haben Sie denn nicht gemessen?“
„Doch.“ „Umtauschmoment“ weiterlesen
Blaumannmannmoment
Es klingelt.
Ich erwarte niemanden. Ich habe nichts bestellt. Es kann nicht für mich sein. Es klingelt öfter tagsüber. Paketboten oder Werbezettelverteiler. Manchmal öffne ich und nehme Pakete für Nachbarn entgegen. Beliebt bin ich nicht bei den Zustellern: 4. Stock Altbau, kein Aufzug.
Es klingelt. „Blaumannmannmoment“ weiterlesen